Stellen Sie sich einmal vor, Ihre Augen hätten sich verschlechtert, Sie gehen zum Augenarzt und der reicht Ihnen kurzerhand seine eigene Brille. Er habe noch eine andere und könne diese entbehren. Sie wäre wohl auch für Ihre Augen passend. Sie probieren die Brille auf und können seinen Eindruck nicht wirklich teilen. Sie sehen jetzt anders aber nicht unbedingt besser als vorher. Der Arzt aber sagt Ihnen, dass das am Anfang ganz normal sei. Man müsse sich erst einmal an das neue Sehen gewöhnen. Ihm habe sie schließlich auch geholfen. Sie könnten ihm vertrauen, er sei schließlich der Experte.
Eine absurde Geschichte, nicht wahr? Aber wie oft haben Sie schon Rat-schläge von Menschen bekommen, die Ihnen genau nach dem gleichen Muster eine Lösung für Ihre Probleme verpassen wollten? Und mal ehrlich: Haben Sie auch schon mal so wie der Augenarzt im Beispiel andere „beraten“? Wahrscheinlich, denn das ist der Alltag. Es ist schwer, zu akzeptieren, dass wir unsere Welt durch eine andere Brille sehen als andere. Aber warum ist das eigentlich so schwer?
Um dies zu verstehen, müssen wir einen kleinen Ausflug in unser Gehirn machen. Was geht eigentlich in unserem Kopf vor, wenn wir die Wirklichkeit, oder genauer gesagt unsere Wirklichkeit wahrnehmen? Es wird Sie vielleicht erstaunen zu erfahren, dass nur ein knappes Sechstel unseres Gehirns Kontakt zur Umwelt hat während der größte Teil unseres Denkorgans mit interner Datenverarbeitung beschäftigt ist. Und nicht nur das: Der größte Teil dessen, was unsere Sinnesorgane wahrnehmen, erreicht aufgrund einer neuronalen Hemmung gar nicht unser Bewusststein. Das Gehirn lässt nur die Informationen bewusst werden, die es aktuell für relevant hält. Und das ist nur ein Bruchteil dessen, was die Rezeptoren unserer Sinne an Signalen registrieren.
Vom „Bauch“ zum Kopf
Unser Bild von Welt ist also nur ein Ausschnitt dessen, was um uns herum geschieht und was wir theoretisch wahrnehmen könnten. Das, was wir wahrnehmen, ist daher niemals die Wirklichkeit, sondern ausschließlich unsere Wirklichkeit. Nun können Sie erahnen, warum Beratung so oft wirkungslos bleibt und Rat-schläge häufig nicht nur Rat sondern auch Schläge enthalten. Schläge sind es deshalb, weil der Ratsuchende sich nicht selten damit konfrontiert sieht, dass jemand seine Welt in Frage stellt, ohne diese wirklich zu kennen. Ein Berater ist also gut beraten, zunächst die Welt des zu Beratenen aus dessen Perspektive zu verstehen, bevor er berät.
Noch ein weiterer Faktor ist relevant: Die neurobiologische Forschung konnte inzwischen zeigen, dass unseren bewussten Entscheidungen von unbewussten dominiert werden. Das bedeutet, dass unser Bewusstsein in der neuronalen Hierarchie nicht oben steht, sondern unbewusste Prozesse darüber stehen. Diese laufen zum großen Teil nicht im Großhirn ab, sondern in tiefer liegenden und entwicklungsgeschichtlich älteren Teilen des Gehirns. Wenn wir meinen, eine bewusste Entscheidung getroffen zu haben, hat unser Stamm- und Mittelhirn diese längst getroffen – etwa eine halbe Sekunde vorher.
Zudem treffen wir den größten Teil unserer Entscheidungen gar nicht bewusst. Auf akute Gefahren reagieren wir mit Flucht oder Abwehr, selbst Fahrrad- oder Autofahren können wir „aus dem Bauch heraus“, wenn wir es einmal gelernt haben. Bestimmte Denk- und Verhaltensmuster prägen sich als Gewohnheit ein. In unserem Gehirn bilden sich über Synapsen Nervenstränge heraus, die mit der Häufigkeit ihrer Erregung gestärkt werden. Neuronale Trampelpfade werden so zu Straßen oder Datenautobahnen. Wir reagieren dann automatisch auf bestimmte Reize – und können scheinbar gar nicht anders. Hat sich zum Beispiel ein Verhalten einmal als nützlich erwiesen, legt uns unser Gehirn nahe, das zu wiederholen. Das ist sehr praktisch, weil effektiv, aber zuweilen auch ausgesprochen lästig, nämlich dann, wenn dieses Verhalten in einem anderen Kontext weniger nützlich oder sogar schädlich ist.
Neue Pfade treten
Genau aus diesem Grund fällt es uns aber oft so schwer, uns zu verändern. Unser Bewusstsein sagt uns vielleicht: „Da läuft was falsch“, aber wir bewegen uns weiter auf den eingefahrenen Bahnen – eben weil unser Unterbewusstsein den bewährten neuronalen Autobahnen oft mehr vertraut, als neuen Trampelpfaden, die erst noch getreten werden müssen. Wenn zum Beispiel ein Kind erfahren hat, dass es nur geliebt wird, wenn es die Erwartungen der Eltern ohne Widerspruch erfüllt, wird es auch als Erwachsener dazu tendieren, Erwartungen von Autoritätspersonen kritiklos zu erfüllen und unter Umständen sogar Herabsetzungen der Person hinnehmen. Das kindliche Verhalten war nützlich, vielleicht sogar notwendig, das Verhalten des selbständigen Erwachsenen ist es nicht mehr und schadet dem Individuum mehr als es nützt. Dennoch schätzt auch der erwachsene Mensch die Gefahr einer Emanzipation von derartigen Abhängigkeiten oft als ungleich größer ein als die Chance, die damit verbunden ist. Die notwendige Veränderung, so sehr sie vielleicht sogar gewünscht wird, bleibt aus.
Dabei, und das macht die Sache kompliziert, kommt es gar nicht darauf an, dass das, was unser Denken und Handeln prägt, auf realen Geschehnissen beruht. Allein der Glaube, dass es so sei, reicht vollkommen aus, um neuronale Muster zu prägen. Unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen real und irreal, sondern allenfalls zwischen der Intensität von Reizen. Eine tiefe emotionale Verletzung wirkt nicht deshalb so tief, weil das Verhalten eines anderen Menschen das zwingend so ergibt, sondern weil das Verhalten eine Kaskade an neuronalen Reizen auslöst, die bereits vorgebahnt ist, die aber bei anderen Menschen zu gänzlich anderen Reaktionen führen kann. Paul Watzlawick hat in seinem grandiosen Buch „Anleitung zum Unglücklichsein“ sogar aufgezeigt, was wir tun können, um unser Gehirn genau in dieser Richtung zu trainieren.
Wie ist Veränderung möglich?
Sind wir also unverbesserlich? Sollten wir aufhören, uns verändern zu wollen? Keineswegs, denn es gibt zwei Quellen, die es uns ermöglichen, unser Denk- und Verhaltensprogramm zu ändern oder zu erweitern. Dies sind zum einen unsere inneren Bedürfnisse, also unsere Antriebe, Leidenschaften und Sehnsüchte. Diese bilden die motivationalen Schemata, wie es in der Psychologie heißt. Und dies ist zum anderen unsere Fähigkeit zur Imagination, das heißt unsere Vorstellungskraft davon, wie unsere Welt aussehen sollte, gespeist von unseren Bedürfnissen. Sich auf das zu besinnen, was uns antreibt, was uns wirklich wichtig ist, was uns innerlich berührt, ist eine Voraussetzung dafür, dass wir uns verändern und unsere Ziele erreichen können. Tun wir das nicht, oder stehen unsere vordergründigen Ziele sogar im Widerspruch zu unseren wichtigsten Bedürfnissen, werden wir unsere Ziele nur unzureichend, oder gar nicht erreichen. Was wir nicht wirklich aus tiefstem Herzen wollen, hat auch keine Attraktivität und strebt nicht nach Umsetzung.
Da wir uns schon oft mit „unserem“ Problem befasst haben, sei es zum Beispiel das ständig misslingende Zeitmanagement oder die Angst vor Prüfungen, stellt sich die Frage, warum wir es bisher nicht oder nur unzureichend gelöst haben und wie wir es besser machen können. Die Antwort wiederum liegt in der Wirkungsweise unseres Gehirns: Der Fokus auf ein Problem festigt die neuronalen Bahnen, welche das Problem und alle damit verbundenen negativen Empfindungen hervorrufen. Es entsteht ein Teufelskreis, in dem wir allenfalls eine immer differenziertere Problemsicht erhalten, aber immer weniger in der Lage sind, das wahrzunehmen, was sich jenseits dessen an Möglichkeiten ergibt. Wir entwickeln zum Schutz Vermeidungsstrategien, verzetteln uns in Nebensächlichkeiten und bewegen uns „weg von“ anstatt „hin zu“ etwas. Dabei ist die Sicht des Problems oft genug schon das Problem an sich, denn sonst hätte es uns ja den Weg zur Lösung gewiesen.
Problemlösungen …
„Die Lösung des Problems ist, wenn das Problem verschwindet“, sagte der Philosoph Wittgenstein. Es kann aber nur dann verschwinden, wenn es uns gelingt, unsere größtenteils unbewussten motivationalen Schemata entsprechend zu nutzen. Der Psychologe Klaus Grawe unterscheidet Annäherungs- und Vermeidungsschemata. Die Aktivierung von Annäherungsschemata geht mit der Ausschüttung von Endorphinen, also körpereigenen Drogen einher, welche unsere Hirnaktivität positiv stimulieren und uns wacher, motivierter, freundlicher stimmen. Daraus folgt: Gelingt es uns zu klären, was wir wirklich wollen und daraus klare Annäherungsziele („was will ich bis wann erreichen?“) zu formulieren, sind wir auf dem richtigen Weg, befinden uns aber meist noch auf der bewussten Ebene. Schaffen wir es darüber hinaus, uns den Zielzustand sinnlich vorzustellen, also uns zu vergegenwärtigen, wie es sich „anfühlt“, wie es aussieht, sich anhört, wenn wir diese Ziele erreicht haben, geben wir unserem Unbewussten einen unschätzbaren Input, mit dem es arbeiten kann. Darüber hinaus geben wir unserem Bewusststein den dazu passenden Ausdruck „Yes, we can!“, um es mit dem amerikanischen Präsidenten Obama zu sagen.
All das hört sich einfach an, aber dieser Prozess fällt Menschen oft genug sehr schwer. Sie kennen sicher Beispiele aus Ihrem eigenen Leben, wo sie wollten, aber nicht konnten. Das kann mehrere Ursachen haben. Oft dominiert Angst vor dem ungewissen Ausgang unser Verhalten. Wir wissen gut, was wir haben und jede Veränderung könnte bedrohlich sein. Oder konkurrierende Ziele blockieren die Veränderung. Anderen Menschen wiederum stehen selbstbeschränkende Glaubenssätze im Weg. „Ach, das können andere doch viel besser als ich…“. Also verändern wir lieber nichts. Bewusstes Wollen hilft da nicht weiter. Erst wenn Sie Ihr Unbewusstes, genauer gesagt, die Anteile, die Ihren inneren Wünschen am nächsten sind, das beste Futter liefern, werden Sie den Mut aufbringen, sich vom Problem weg hin zu Lösungen zu bewegen.
Als Unterstützung hierfür ist Coaching mit Hilfe der neurolinguistischen Programmierung (NLP) ein ideales Werkzeug. Es ist zielorientiert, respektiert Ihre „innere Landkarte“, stärkt Ihre Ressourcen und versucht nicht, Ihnen Lösungen anzugedeihen, die nicht zu Ihnen passen. Es stülpt Ihnen auch keine psychotherapeutische Diagnose über. Kurzum: Sie bekommen keine Brille aufgesetzt, mit der Sie allenfalls die Welt aus der Sicht des Beraters wahrnehmen. Und dennoch: Der Coach wird Ihnen helfen, Entdeckungen zu machen, und neue Perspektiven einzunehmen. Er wird Ihnen Wahrnehmungen ermöglichen, die Sie weg vom Problem und hin zu Lösungen führen. Coaching ist daher ein mächtiges Instrument, wenn Sie Unterstützung in Veränderungsprozessen brauchen. Es dreht nicht an Schräubchen, sondern bringt Ihren inneren Motor auf Touren. Und das nachhaltig.
(in BusinessVillage Online-Magazin)
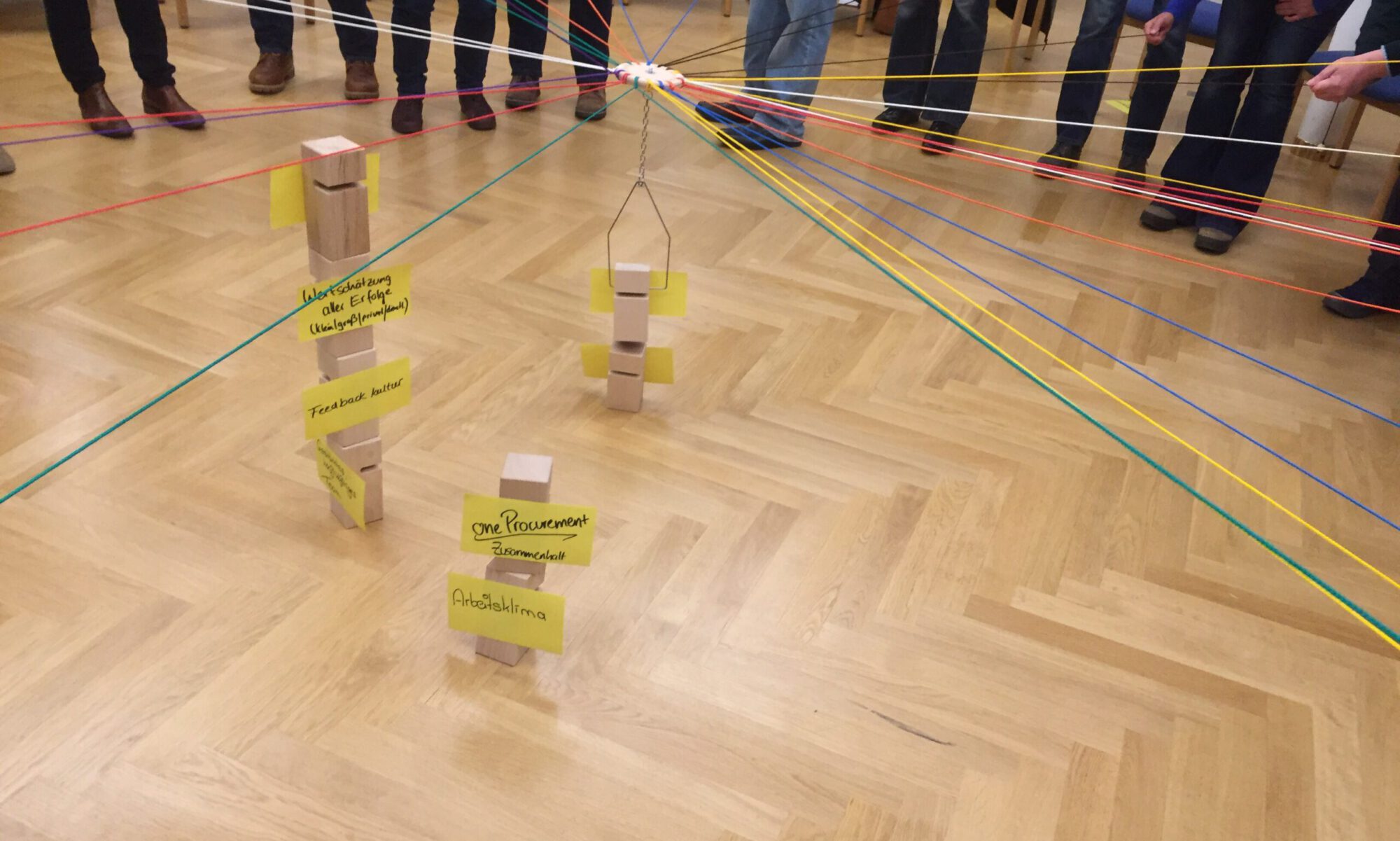
zu ABS 4 letzter Satz : ‚Ein Berater ist also gut beraten, zunächst die Welt des ( Beratenden ) aus dessen Perspektive zu verstehen, bevor er berät.‘
Ist die Aussage korrekt ? Oder ? Ist folgende Aussage gemeint ?
‚Ein Berater ist also gut beraten, zunächst die Welt des ( zu Beratenden ) aus dessen Perspektive zu verstehen, bevor er berät.‘
Hallo Herr Pengler,
da haben Sie sehr aufmerksam gelesen. Danke für den Hinweis. Ich habe es geändert.
Herzliche Grüße
Constantin